Probezeit und Kündigungsschutz – wer die Spielregeln kennt, verliert seinen Job nicht. Dieser Artikel zeigt dir, wie du jede Kündigung in der Probezeit rechtlich abwehrst.
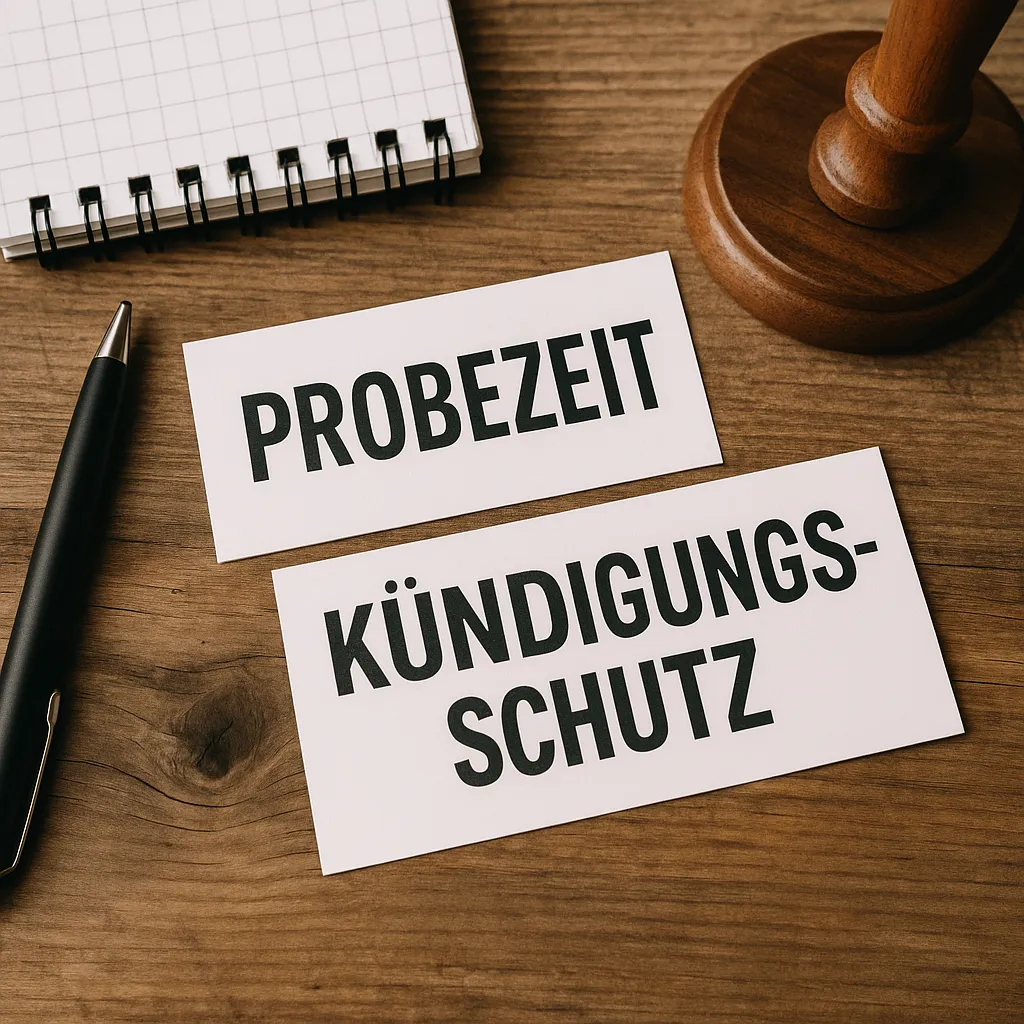
Rechtlicher Rahmen der Probezeit
Gesetzliche Grundlagen im Überblick
Unterschied Probezeit und Kündigungsschutz
In Deutschland verwechseln viele Arbeitnehmer die Begriffe Probezeit und Kündigungsschutz, obwohl sie rechtlich völlig verschiedene Funktionen haben. Die Probezeit ist eine Erprobungsphase, in der beide Seiten prüfen, ob das Arbeitsverhältnis dauerhaft bestehen soll (§622 Abs. 3 BGB). Der Kündigungsschutz dagegen ist ein rechtlicher Schild, der erst nach einer gewissen Beschäftigungsdauer greift (§1 Abs. 1 KSchG). Diese Trennung ist entscheidend, denn während der Probezeit gilt das Kündigungsschutzgesetz in der Regel noch nicht – eine Einsicht, die viele erst nach einem unangenehmen Gespräch im Büro gewinnen. Man könnte sagen, die Probezeit prüft das Vertrauen, während der Kündigungsschutz es rechtlich festigt.
Definition arbeitsrechtlicher Grundlagen
Arbeitsrechtlich gesehen ist die Probezeit ein Teil des Arbeitsverhältnisses, nicht eine Vorstufe davon. Das bedeutet, der Arbeitnehmer hat bereits alle Rechte aus dem Vertrag – nur die Kündigungsbedingungen sind erleichtert. Der Kündigungsschutz nach dem KSchG greift hingegen erst nach sechs Monaten ununterbrochener Beschäftigung (§1 Abs.1 KSchG). Diese Wartezeit ist keine Schikane, sondern ein Balanceakt zwischen betrieblichem Interesse und individueller Sicherheit – ein Gedanke, der auf die Reformen der 1960er Jahre zurückgeht, als Deutschland nach neuen sozialrechtlichen Leitlinien suchte.
Bedeutung der Wartezeit nach KSchG
Die sogenannte Wartezeit ist ein juristischer Prüfstein. Erst nach sechs Monaten entsteht ein Anspruch auf allgemeinen Kündigungsschutz. Das heißt: Auch wer in der Probezeit glänzt, steht vor Ablauf dieser Frist ohne den Schutz des KSchG da. Es ist wie eine unsichtbare Linie – man arbeitet, leistet und wartet darauf, rechtlich als „vollwertig“ zu gelten. Laut Bundesarbeitsgericht (BAG, Urteil vom 24.01.2008 – 6 AZR 96/07) zählt dabei nicht das Datum im Vertrag, sondern der tatsächliche Beginn der Tätigkeit.
Verwechslung mit Kündigungsfrist
Oft wird die Wartezeit fälschlich mit der Kündigungsfrist verwechselt. Doch diese Frist – meist zwei Wochen – ist etwas ganz anderes: Sie regelt lediglich den Zeitraum zwischen Kündigung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses (§622 Abs.3 BGB). Wer hier den Unterschied übersieht, glaubt schnell, nach Ablauf von zwei Wochen automatisch Schutz zu genießen, was rechtlich nicht zutrifft.
BAG-Urteile zur Unterscheidung
Das Bundesarbeitsgericht hat mehrfach klargestellt, dass Probezeit und Kündigungsschutz zwei getrennte Rechtsbereiche sind (BAG, Urteil v. 23.03.2017 – 6 AZR 705/15). Das Gericht betonte, dass selbst während der Probezeit eine Kündigung begründet, aber nicht zwingend gerechtfertigt sein muss – was im Einzelfall über Fairness oder Willkür entscheidet.
Definition der Probezeit nach BGB
Die gesetzliche Grundlage der Probezeit findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch, genauer im §622 Abs.3 BGB. Dort heißt es, dass während einer vereinbarten Probezeit von bis zu sechs Monaten das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden kann. Diese scheinbar einfache Regel birgt komplexe Dynamiken zwischen Vertrauen, Risiko und rechtlicher Verantwortung.
Dauer laut §622 BGB
Die maximale Dauer der Probezeit beträgt sechs Monate, und das ist kein Zufall. Der Gesetzgeber wollte einen fairen Zeitraum schaffen, um Leistung, Verhalten und Integration zu bewerten, ohne Arbeitnehmer dauerhaft unter Unsicherheit zu halten. Eine längere Probezeit gilt daher als rechtswidrig, es sei denn, ein Tarifvertrag sieht Ausnahmen vor.
Verlängerung durch Tarifvertrag
Einige Branchen nutzen tarifvertragliche Regelungen, um die Probezeit zu verlängern, insbesondere bei komplexen Tätigkeiten mit längeren Einarbeitungsphasen. Doch selbst hier bleibt die Grenze von sechs Monaten rechtlich bindend (§622 Abs.3 BGB). Verlängerungen müssen sachlich begründet und vertraglich eindeutig festgelegt werden, sonst gelten sie als unzulässig (BAG, Urteil v. 07.03.2002 – 2 AZR 93/01).
Unzulässige Klauseln in Verträgen
Viele Arbeitsverträge enthalten unbestimmte Klauseln wie „Probezeit verlängert sich automatisch bei Krankheit“. Solche Regelungen sind nach ständiger Rechtsprechung unzulässig, da sie gegen das Transparenzgebot des §307 BGB verstoßen. Arbeitgeber müssen klar definieren, wie und wann eine Probezeit endet.
Gerichtsurteile zur Probezeit
Gerichte betonen regelmäßig, dass die Probezeit kein rechtsfreier Raum ist. Kündigungen dürfen zwar erleichtert erfolgen, doch sie müssen nachvollziehbar und nicht diskriminierend sein (BAG, Urteil v. 21.03.2013 – 2 AZR 60/12). Arbeitnehmer behalten Anspruch auf Zeugnis, Resturlaub und Lohnfortzahlung – auch im Fall einer Probezeitkündigung.
Verkürzte Probezeit Kündigungsschutz
In seltenen Fällen wird eine verkürzte Probezeit vereinbart, etwa bei Wiedereinstellungen oder internen Versetzungen. Sie verändert das Verhältnis von Vertrauen und Schutz spürbar.
Vertragsfreiheit und AGB-Kontrolle
Obwohl Arbeitgeber bei der Vertragsgestaltung grundsätzlich frei sind, unterliegt die Probezeitvereinbarung der AGB-Kontrolle nach §307 BGB. Eine zu kurze Probezeit kann ebenso wie eine zu lange unangemessen sein, wenn sie die Interessenlage verzerrt.
Auswirkungen auf Kündigungsschutz
Eine verkürzte Probezeit kann den Beginn des Kündigungsschutzes faktisch vorverlegen. Endet die Probezeit vor Ablauf der sechsmonatigen Wartezeit, so gilt zwar das KSchG noch nicht, aber der Arbeitnehmer hat in der Praxis ein stärkeres Argumentationsfeld gegenüber willkürlichen Kündigungen.
Arbeitgeberpflichten bei Verkürzung
Wird eine verkürzte Probezeit vereinbart, muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass die Einarbeitung strukturiert und nachvollziehbar erfolgt. Andernfalls kann eine Kündigung trotz formaler Rechtmäßigkeit als missbräuchlich gelten (BAG, Urteil v. 16.02.2012 – 6 AZR 553/10).
Beispiele aus Tarifverträgen
Im Bankwesen oder im öffentlichen Dienst finden sich häufig Beispiele, in denen Tarifverträge eine verkürzte Probezeit von drei Monaten festlegen, um rasch über eine Weiterbeschäftigung zu entscheiden. Diese Modelle zeigen, wie unterschiedlich Branchen rechtliche Flexibilität gestalten können.
Kündigungsfrist während der Probezeit
Die Kündigungsfrist ist der juristische Taktgeber der Probezeit. Sie bestimmt, wie viel Zeit zwischen Entscheidung und Ende bleibt – und das oft über Karrieren hinweg.
Zwei-Wochen-Frist nach §622 Abs.3 BGB
Nach §622 Abs.3 BGB gilt während der Probezeit eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Sie beginnt unabhängig von der Dauer der Probezeit, sobald die Kündigung ausgesprochen wird. Diese Regelung erlaubt beiden Seiten, sich flexibel voneinander zu lösen.
Beginn und Berechnung der Frist
Der Fristbeginn ist an den Zugang der Kündigung gebunden (§130 BGB). Entscheidend ist also nicht das Versanddatum, sondern der Moment, in dem der Arbeitnehmer das Schreiben tatsächlich erhält. In der Praxis führt das oft zu Streit, wenn das Schreiben am Wochenende oder kurz vor Feierabend zugestellt wird.
Fristverkürzung durch Vertrag?
Eine noch kürzere Frist ist grundsätzlich unzulässig, da sie den Arbeitnehmer unangemessen benachteiligt (§307 BGB). Nur tarifvertragliche Abweichungen sind erlaubt, wenn sie im Brancheninteresse liegen.
Ausschluss durch Sonderregelungen
Bestimmte Gruppen, wie Schwangere oder Schwerbehinderte, sind auch in der Probezeit durch Sonderregelungen geschützt (§17 MuSchG, §168 SGB IX). Diese Vorschriften stehen über der allgemeinen Kündigungsfreiheit der Probezeit und zeigen, dass das Arbeitsrecht trotz Flexibilität stets soziale Grenzen wahrt.
Anwendungsbereich und Besonderheiten
Kündigungsschutz Probezeit 3 Monate
Drei Monate gelten in vielen Betrieben als Standardprobezeit. Doch rechtlich betrachtet ist das eine reine Gewohnheit, keine Vorschrift.
Fehlannahmen über gesetzliche Dauer
Viele glauben, die Probezeit sei gesetzlich auf drei Monate begrenzt. Das stimmt nicht. Die sechs Monate des §622 Abs.3 BGB sind eine Höchst-, keine Sollvorgabe.
Schutzlücke bei verkürzter Probezeit
Wird die Probezeit verkürzt, entsteht oft eine Schutzlücke: Der Kündigungsschutz greift noch nicht, die Probezeit ist aber schon vorbei. Das kann zu rechtlichen Grauzonen führen, etwa wenn Arbeitgeber kurz danach kündigen, um das KSchG zu umgehen.
Auswirkungen auf Kündigungsmodalitäten
Je kürzer die Probezeit, desto stärker muss die Kündigung begründet werden. Gerichte achten zunehmend darauf, ob betriebliche Gründe plausibel sind oder bloß vorgeschoben wirken (BAG, Urteil v. 10.10.2018 – 7 AZR 168/17).
Kündigungsschutz probezeit ausbildung
Bei Ausbildungsverhältnissen gelten völlig andere Spielregeln.
Sonderregelung nach §22 BBiG
Nach §22 Abs.1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) kann ein Ausbildungsverhältnis während der Probezeit jederzeit und fristlos gekündigt werden. Das soll beiden Seiten die Freiheit geben, früh zu erkennen, ob die Ausbildung passt.
Kündigung ohne Frist in der Probezeit
Die fristlose Kündigung in der Ausbildungsprobezeit bedeutet nicht Willkür, sondern Schutz vor Fehlentwicklung. Dennoch müssen sachliche Gründe vorliegen – etwa mangelnde Eignung oder grobes Fehlverhalten.
Rechtsprechung zur Schutzwirkung
Das Bundesarbeitsgericht hat wiederholt betont, dass selbst Auszubildende während der Probezeit nicht rechtlos sind (BAG, Urteil v. 29.04.2015 – 9 AZR 108/14). Diskriminierung oder Schikane können auch hier zur Unwirksamkeit einer Kündigung führen.
Probezeit im öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst gelten traditionsgemäß andere Maßstäbe, die stärker auf Transparenz und Gleichbehandlung ausgerichtet sind.
TVöD und Sonderregelungen
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) regelt die Probezeit meist auf sechs Monate, erlaubt aber Abweichungen bei besonderen Tätigkeiten. Anders als in der Privatwirtschaft spielt hier der Leistungsnachweis eine größere Rolle als die reine Vertragsfreiheit.
Übernahme nach der Probezeit
Nach erfolgreicher Probezeit erfolgt im öffentlichen Dienst häufig eine automatische Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Diese Übergänge sind nicht bloß Formalität, sondern Ausdruck des Beamtenrechtsgedankens: Wer sich bewährt, erhält Stabilität.
Kündigungsschutz bei Schwangerschaft in der Probezeit 👆Kündigungsschutz in der Probezeit
Allgemeine Kündigungsschutzregelungen
Geltung des KSchG
Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ist das zentrale Schutzinstrument für Arbeitnehmer in Deutschland – aber es greift nicht sofort. Viele gehen irrtümlich davon aus, dass mit dem ersten Arbeitstag auch der volle gesetzliche Kündigungsschutz beginnt. Doch tatsächlich müssen dafür zwei Bedingungen erfüllt sein: Der Betrieb muss eine gewisse Größe haben und das Arbeitsverhältnis muss eine bestimmte Dauer überschreiten. Ohne diese Voraussetzungen gilt nur ein eingeschränkter Basisschutz, der im Ernstfall wenig nützt.
Schwellenwert von 10 Mitarbeitern
Ein oft übersehener Aspekt ist der betriebliche Schwellenwert. Das KSchG findet nur Anwendung, wenn in der Regel mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter im Betrieb beschäftigt sind (§23 Abs.1 KSchG). Teilzeitkräfte werden anteilig gewichtet. In Kleinbetrieben mit weniger als zehn Mitarbeitenden besteht daher kein allgemeiner Kündigungsschutz – unabhängig von der Probezeit. Für viele bedeutet das: Auch nach sechs Monaten kann eine Kündigung erfolgen, ohne dass sie sozial gerechtfertigt werden muss.
Wartezeit von 6 Monaten
Zusätzlich zur Betriebsgröße ist eine Wartezeit von sechs Monaten erforderlich, bevor der Kündigungsschutz nach dem KSchG greift (§1 Abs.1 KSchG). Diese Wartezeit beginnt mit dem tatsächlichen Beschäftigungsbeginn – nicht mit dem Datum auf dem Arbeitsvertrag. In dieser Phase kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten ohne Angabe von Gründen beendet werden, solange keine Sonderregelungen greifen.
Kein Kündigungsschutz nach KSchG
Solange die beiden oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, bleibt der Kündigungsschutz rudimentär. Und genau das macht die Probezeit so heikel: Die rechtliche Schwelle zur Kündigung ist niedrig, der Druck auf Beschäftigte oft hoch.
Bedeutung für neue Mitarbeiter
Gerade Berufseinsteiger und Quereinsteiger unterschätzen häufig die Bedeutung dieser Wartezeit. Sie verlassen sich auf einen sicheren Vertrag und bemerken zu spät, dass der gesetzliche Schutz erst später greift. Wer sich in dieser Phase nicht absichert, etwa durch Dokumentation von Gesprächen oder aktive Rückmeldung im Team, steht im Ernstfall alleine da.
Abgrenzung zur fristlosen Kündigung
Ein verbreitetes Missverständnis besteht darin, dass in der Probezeit ausschließlich ordentliche Kündigungen möglich seien. Doch auch fristlose Kündigungen sind zulässig – allerdings nur unter den strengen Voraussetzungen des §626 BGB. Der Unterschied liegt im Kündigungsgrund: Während eine ordentliche Kündigung während der Probezeit keiner Begründung bedarf, muss eine fristlose Kündigung stets durch einen gravierenden Vertrauensbruch gerechtfertigt sein.
Sonderkündigungsschutz in der Probezeit
Schwangerschaft und Mutterschutz
Auch in der Probezeit sind bestimmte Personengruppen vor Kündigungen besonders geschützt. Eine davon sind schwangere Arbeitnehmerinnen – ein Thema, das oft emotional diskutiert wird, aber juristisch klar geregelt ist.
§17 MuSchG im Überblick
Nach §17 Abs.1 Mutterschutzgesetz (MuSchG) ist die Kündigung einer Frau während der Schwangerschaft und bis vier Monate nach der Entbindung grundsätzlich unzulässig – unabhängig davon, ob sie sich in der Probezeit befindet oder nicht. Das ist kein Goodwill, sondern eine gesetzlich garantierte Schutzfrist.
Mitteilungspflicht an Arbeitgeber
Der Kündigungsschutz greift allerdings nur, wenn der Arbeitgeber von der Schwangerschaft weiß oder innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung darüber informiert wird (§17 Abs.1 MuSchG). Diese Frist wird oft übersehen – mit fatalen Folgen.
Unzulässigkeit der Kündigung
Eine Kündigung, die trotz Kenntnis der Schwangerschaft ausgesprochen wird, ist in der Regel unwirksam. Arbeitgeber machen sich unter Umständen sogar schadensersatzpflichtig, wenn sie diesen Schutz missachten.
Ausnahmegenehmigung durch Behörde
Nur in absoluten Ausnahmefällen kann die Kündigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt werden – zum Beispiel bei Betriebsschließung oder massiven Pflichtverletzungen. Diese Ausnahmen werden streng geprüft.
Schwerbehinderung
Auch schwerbehinderte Menschen genießen in der Probezeit einen erweiterten Kündigungsschutz, der häufig unterschätzt wird.
Kündigung nur mit Zustimmung vom Integrationsamt
Nach §168 SGB IX darf ein Arbeitgeber einen schwerbehinderten Arbeitnehmer nur mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamts kündigen – auch während der Probezeit. Diese Zustimmung ist keine Formsache, sondern unterliegt einer intensiven Prüfung.
Meldepflicht und Frist
Wichtig ist, dass die Schwerbehinderung dem Arbeitgeber bekannt ist. Wurde sie verschwiegen, entfällt der besondere Schutz – ein Dilemma, das viele Betroffene erleben.
BAG-Rechtsprechung zur Probezeit
Das Bundesarbeitsgericht hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass die Zustimmungspflicht auch dann gilt, wenn sich das Arbeitsverhältnis noch in der Erprobungsphase befindet (BAG, Urteil v. 12.03.2003 – 2 AZR 292/02). Der Kündigungsschutz ist also nicht aufgeschoben, sondern voll wirksam.
Elternzeit und Pflegezeit
Manchmal fallen Schwangerschaft, Elternzeit oder familiäre Pflege direkt in die Probezeit – eine rechtliche Grauzone, in der Fehler schnell teuer werden können.
§18 BEEG – Schutz bei Elternzeit
Nach §18 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) ist die Kündigung während der Elternzeit nur mit behördlicher Zustimmung zulässig. Der Antrag muss gut begründet und der Schutzzeitraum eindeutig definiert sein.
Kündigung nach PflegeZG
Auch wer nahe Angehörige pflegt, genießt nach dem Pflegezeitgesetz (PflegeZG) unter bestimmten Bedingungen Kündigungsschutz. Dieser ist oft nicht bekannt – was dazu führt, dass Betroffene ihre Rechte nicht einfordern.
Betriebsratsmitglieder und Azubis
In der arbeitsrechtlichen Landschaft nehmen Betriebsratsmitglieder und Auszubildende eine Sonderrolle ein, die auch während der Probezeit wirksam ist.
Kündigungsschutz probezeit ausbildung
Auszubildende können während der Probezeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden (§22 BBiG). Doch dieser Schutzverlust endet mit dem letzten Tag der Probezeit – danach greift ein deutlich höheres Schutzniveau.
§15 KSchG und BBiG
Betriebsratsmitglieder sind nach §15 KSchG unkündbar – selbst in der Probezeit. Das ergibt sich aus dem besonderen Amtsschutz, der die freie Betriebsratsarbeit gewährleisten soll.
Abgrenzung zur regulären Anstellung
Für normale Arbeitnehmer gelten diese Regeln nicht. Wer nicht schwerbehindert, schwanger oder im Betriebsrat ist, muss in der Probezeit mit deutlich weniger Schutz auskommen – ein Umstand, den viele erst bei ihrer ersten Kündigung realisieren.
Rechtsmittel und Handlungsoptionen
Kündigungsschutzklage
Wer denkt, dass eine Kündigung in der Probezeit unangemessen oder willkürlich war, hat die Möglichkeit, eine Kündigungsschutzklage zu erheben. Doch die Uhr tickt.
Drei-Wochen-Frist beachten
Nach §4 KSchG muss die Klage binnen drei Wochen nach Zugang der Kündigung beim Arbeitsgericht eingehen. Wird diese Frist versäumt, gilt die Kündigung als wirksam – selbst wenn sie rechtswidrig war.
Erfolgsaussichten in der Probezeit
Zugegeben, die Erfolgschancen einer Klage sind während der Probezeit begrenzt. Dennoch gibt es immer wieder Fälle, in denen Gerichte formale Fehler oder Missbrauch erkennen und die Kündigung aufheben (vgl. LAG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 18.08.2020 – 8 Sa 105/20).
Beispiele aus der Rechtsprechung
Gerichte haben Kündigungen in der Probezeit beispielsweise für unwirksam erklärt, wenn sie diskriminierend oder aus Rache erfolgten. Auch fehlende Anhörung bei Schwerbehinderten oder formale Fehler wie das Fehlen der Originalunterschrift können zur Unwirksamkeit führen.
Mediation und interne Klärung
Nicht jeder Streit muss vor Gericht enden. Oft lassen sich Missverständnisse oder Konflikte bereits intern lösen – sofern beide Seiten gesprächsbereit sind.
Gespräch mit Vorgesetzten
Ein offenes, sachliches Gespräch mit der Führungskraft kann helfen, die Situation zu entschärfen und möglicherweise sogar den Kündigungsprozess zu stoppen. Timing, Ton und Vorbereitung sind hier entscheidend.
Unterstützung durch Betriebsrat
Der Betriebsrat kann als vermittelnde Instanz auftreten. Auch in der Probezeit hat er ein Anhörungsrecht (§102 BetrVG) und kann Missstände benennen – oft mit größerem Einfluss, als viele vermuten.
Kündigung nach Elternzeit Arbeitgeber: Was du jetzt wissen musst 👆Tipps für Arbeitnehmer in der Probezeit
Verhalten im Falle einer Kündigung
Kündigung nach Probezeit Arbeitnehmer
Rechte nach Ablauf der Probezeit
Wenn die Probezeit offiziell endet, atmen viele Arbeitnehmer erleichtert auf. Aber was bedeutet das konkret? Mit Ablauf der Probezeit gelten nicht automatisch alle Schutzmechanismen des Kündigungsschutzgesetzes. Erst nach sechs Monaten ununterbrochener Beschäftigung beginnt der allgemeine Kündigungsschutz nach §1 KSchG zu greifen – eine Frist, die mit der tatsächlichen Arbeitsaufnahme zählt, nicht mit Vertragsunterzeichnung. Wer also genau ab diesem Zeitpunkt gekündigt wird, sollte genau prüfen, ob diese sechs Monate tatsächlich erfüllt sind. Besonders trickreich: Manchmal endet die Probezeit, bevor die Wartezeit für das KSchG abgeschlossen ist. In diesem Fall existiert zwar keine Probezeit mehr, aber auch noch kein Kündigungsschutz.
Rechtlicher Status bei unbefristetem Vertrag
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag vermittelt gerne das Gefühl von Sicherheit – leider trügerisch. Denn während der Probezeit oder innerhalb der sechsmonatigen Wartezeit kann auch ein unbefristeter Vertrag relativ unkompliziert gekündigt werden. Die Art des Vertrags – befristet oder unbefristet – sagt rechtlich nichts über die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes aus. Nur die Dauer der Betriebszugehörigkeit und die Betriebsgröße sind entscheidend (§1 und §23 KSchG). Ein häufiger Denkfehler, der emotional tief trifft, wenn das Kündigungsschreiben plötzlich im Briefkasten liegt.
Kündigung nach Probezeit unbefristeter Arbeitsvertrag
Nach Probezeit Kündigungsschutz
Sobald die Wartezeit abgeschlossen ist, greift das Kündigungsschutzgesetz. Das bedeutet: Eine Kündigung muss sozial gerechtfertigt sein, also entweder durch verhaltens-, betriebs- oder personenbedingte Gründe gestützt werden (§1 Abs.2 KSchG). Arbeitgeber müssen ab diesem Moment genau dokumentieren, warum eine Kündigung erfolgt. Einfach zu sagen „es passt nicht mehr“ reicht dann nicht mehr aus.
Anwendbarkeit des KSchG
Doch Vorsicht: Das Gesetz gilt nur, wenn mehr als zehn Vollzeitkräfte im Betrieb arbeiten (§23 KSchG). In kleineren Betrieben bleibt der Schutz eingeschränkt – selbst nach der Probezeit. Diese Unterscheidung kennt kaum jemand, dabei entscheidet sie im Zweifel über Existenz oder Arbeitslosigkeit.
Weiterbeschäftigungspflicht
In manchen Fällen haben Arbeitnehmer Anspruch auf eine Weiterbeschäftigung – zum Beispiel, wenn die Kündigung wegen Krankheit erfolgt und keine dauerhafte Leistungsminderung vorliegt. Dies ist durch die Rechtsprechung des BAG mehrfach bestätigt worden (vgl. BAG, Urteil v. 10.05.2007 – 2 AZR 626/05). Wer hier nicht um seine Rechte kämpft, verzichtet stillschweigend auf seinen Arbeitsplatz.
Kündigung nach Probezeit Gründe
Leistungsbezogene Gründe
Leistungsschwäche ist einer der häufigsten Kündigungsgründe – auch nach der Probezeit. Doch es reicht nicht, wenn der Arbeitgeber bloß unzufrieden ist. Er muss objektiv darlegen können, dass die Leistung über einen längeren Zeitraum hinweg deutlich unter dem Durchschnitt lag und sich trotz konkreter Hinweise nicht verbessert hat. Dabei spielen Zielvereinbarungen, Arbeitsberichte oder Kundenzufriedenheit eine wichtige Rolle – vor Gericht kann das entscheidend sein.
Verhaltensbedingte Gründe
Hier wird’s emotional: Wer gegen Anweisungen verstößt, häufig zu spät kommt oder sich unkollegial verhält, riskiert eine verhaltensbedingte Kündigung. Diese muss jedoch in aller Regel durch mindestens eine Abmahnung vorbereitet sein, damit der Arbeitnehmer Gelegenheit zur Verhaltensänderung hatte (§314 BGB i.V.m. §626 BGB). Ohne diese Vorwarnung ist die Kündigung oft angreifbar.
Betriebsbedingte Gründe
Diese Kategorie ist besonders heikel, weil sie oft wirtschaftlich bedingt ist – und damit außerhalb der Kontrolle des Einzelnen liegt. Wenn z. B. ein Standort geschlossen oder eine Abteilung automatisiert wird, kann das zu betriebsbedingten Kündigungen führen. Allerdings muss der Arbeitgeber dann auch eine Sozialauswahl treffen (§1 Abs.3 KSchG). Das bedeutet: Wer sozial schutzwürdiger ist, muss bevorzugt werden.
Nachweispflicht und Dokumentation
In allen Fällen gilt: Arbeitgeber müssen sauber dokumentieren. Wer die Kündigung nachvollziehbar begründen kann, hat juristisch bessere Karten. Wer das nicht tut, riskiert eine erfolgreiche Kündigungsschutzklage. Arbeitnehmer sollten deshalb frühzeitig selbst mitdokumentieren – Gespräche, Mails, Aufgaben. Nicht aus Misstrauen, sondern aus Verantwortung für sich selbst.
Strategien zur rechtlichen Absicherung
Arbeitsvertrag sorgfältig prüfen
Klauseln zur Probezeit analysieren
Viele Probleme beginnen mit einer unterschriebenen Zeile: der Vertragsklausel zur Probezeit. Oft finden sich dort Formulierungen wie „Verlängerung bei Krankheit möglich“ oder „Kündigung jederzeit ohne Angabe von Gründen“. Solche Formulierungen sind nicht nur kritisch, sie können sogar rechtswidrig sein, wenn sie gegen §307 BGB (Transparenzgebot) verstoßen. Wer sich Zeit nimmt, diese Klauseln vorab zu prüfen oder prüfen zu lassen, gewinnt Sicherheit.
Widerrufsmöglichkeiten im Arbeitsrecht
Das deutsche Arbeitsrecht kennt keine klassische Widerrufsfrist wie beim Onlinekauf. Aber: Wurde ein Vertrag unter Druck oder in einem sogenannten Haustürgeschäft abgeschlossen, kann unter Umständen das Widerrufsrecht aus dem BGB greifen (§312g i.V.m. §355 BGB). Zwar selten – aber in einigen Fällen vor Gericht schon erfolgreich angewendet.
Rechtzeitig Mitglied in Gewerkschaft werden
Rechtsschutz und Beratung
Gewerkschaften bieten nicht nur Kaffeetassen und Streiks. Vor allem liefern sie im Ernstfall Rechtsbeistand – und das oft kostenfrei für Mitglieder. Wer rechtzeitig beitritt, profitiert vom gewerkschaftlichen Rechtsschutz, der auch bei Kündigungsschutzklagen greift. Besonders in Branchen mit hoher Fluktuation ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Unterstützung im Streitfall
Gewerkschaften haben politische Macht, Netzwerke und Erfahrung. Wer allein kämpft, verliert oft gegen größere Strukturen. In Verhandlungen über einen Aufhebungsvertrag oder bei Abfindungsgesprächen sind gewerkschaftliche Vertreter oft effektiver als Anwälte – weil sie nicht nur juristisch, sondern auch strategisch agieren.
Alternativen zur Kündigung
Aufhebungsvertrag in der Probezeit
Vorteile gegenüber Kündigung
Ein Aufhebungsvertrag kann in der Probezeit eine elegante Lösung sein – wenn er fair gestaltet ist. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit, Inhalte mitzubestimmen: Austrittsdatum, Zeugnisformulierung, mögliche Abfindung. Es ist ein Ausstieg mit Würde, nicht mit einem bitteren Nachgeschmack.
Risiken beim Abschluss
Doch aufgepasst: Wer leichtfertig unterschreibt, riskiert eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld (§159 SGB III). Auch können Formulierungen über das Verhalten oder die Leistung später Probleme machen – etwa beim neuen Arbeitgeber. Deshalb: Niemals unter Zeitdruck unterschreiben, sondern immer rechtlich prüfen lassen.
Gespräch über Versetzung oder Verlängerung
Perspektivenwechsel intern
Nicht jede Kündigung bedeutet das Ende. Manchmal fehlt es nur am richtigen Platz im Unternehmen. Ein offenes Gespräch über eine interne Versetzung kann Türen öffnen – sei es in eine andere Abteilung oder an einen anderen Standort. Das zeigt Initiative und Veränderungsbereitschaft, was bei Vorgesetzten gut ankommt.
Verlängerung der Probezeit als Chance
Klingt im ersten Moment wie ein Rückschritt – ist es aber nicht immer. Wenn die Probezeit verlängert wird, bedeutet das oft: Man sieht Potenzial, möchte aber mehr Sicherheit gewinnen. Für den Arbeitnehmer kann das eine zweite Chance sein, sich zu beweisen – mit klaren Zielvorgaben und Rückmeldung. Auch das ist Wachstum, wenn man es aktiv gestaltet.
Kündigung bei Schwangerschaft in der Probezeit – Das musst du sofort wissen! 👆Fazit
Wer die Feinheiten rund um Probezeit und Kündigungsschutz kennt, kann sich gezielt vor unangenehmen Überraschungen schützen. Die juristische Landschaft mag auf den ersten Blick komplex wirken – doch wer sich einmal die Mühe macht, die Strukturen zu verstehen, erkennt schnell, wo Risiken lauern und wo man Rechte geltend machen kann. Die Probezeit ist keine rechtsfreie Grauzone, sondern ein Zeitraum, in dem Fairness und Gesetzgebung durchaus ineinandergreifen. Und auch wenn der Kündigungsschutz erst später greift, ist man nicht völlig wehrlos – im Gegenteil: Mit dem richtigen Wissen, einer klaren Strategie und gegebenenfalls gewerkschaftlicher Unterstützung lassen sich viele Kündigungen verhindern oder zumindest sinnvoll verhandeln. Wer also vorbereitet ist, braucht keine Angst vor der Probezeit zu haben – sondern kann sie als das sehen, was sie eigentlich sein sollte: eine Chance zur beidseitigen Orientierung.
Aufhebungsvertrag seitens des Arbeitnehmers 👆FAQ
Gilt das Kündigungsschutzgesetz auch in der Probezeit?
Nein, das Kündigungsschutzgesetz greift grundsätzlich erst nach sechs Monaten ununterbrochener Betriebszugehörigkeit (§1 Abs.1 KSchG) – unabhängig davon, wie lange die Probezeit vereinbart wurde.
Kann ich in der Probezeit ohne Grund gekündigt werden?
Ja, eine Kündigung während der Probezeit bedarf keiner Begründung. Sie muss jedoch formal korrekt erfolgen, darf nicht diskriminierend sein und bestimmte Schutzfristen (z. B. bei Schwangerschaft) dürfen nicht verletzt werden.
Wie lang ist die Kündigungsfrist in der Probezeit?
Nach §622 Abs.3 BGB beträgt die Kündigungsfrist während der Probezeit zwei Wochen – unabhängig davon, ob sie vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ausgesprochen wird.
Was passiert, wenn die Probezeit kürzer als sechs Monate ist?
Dann endet die Probezeit zwar früher, aber der Kündigungsschutz nach KSchG greift trotzdem erst nach sechs Monaten. Es entsteht also eine Schutzlücke, in der das Arbeitsverhältnis ohne besonderen Kündigungsgrund beendet werden kann.
Kann eine Probezeit verlängert werden?
Nur in Ausnahmefällen – etwa durch tarifvertragliche Regelungen oder bei späterem Arbeitsbeginn. Eine automatische Verlängerung wegen Krankheit ist rechtlich problematisch (§307 BGB).
Muss ich als Schwangere während der Probezeit mit einer Kündigung rechnen?
Nein, denn nach §17 MuSchG besteht auch während der Probezeit ein Kündigungsverbot, sofern der Arbeitgeber über die Schwangerschaft informiert wurde oder innerhalb von zwei Wochen nach Kündigungszugang informiert wird.
Habe ich während der Probezeit Anspruch auf Resturlaub?
Ja, grundsätzlich besteht ein anteiliger Urlaubsanspruch auch während der Probezeit, sofern bereits ein entsprechender Zeitraum im Unternehmen gearbeitet wurde (§5 BUrlG).
Wann lohnt sich eine Kündigungsschutzklage in der Probezeit?
Wenn der Verdacht besteht, dass die Kündigung diskriminierend, willkürlich oder formell fehlerhaft erfolgte. Auch bei fehlender Anhörung des Betriebsrats kann eine Klage Erfolg haben – allerdings sind die Chancen in der Probezeit begrenzt.
Ist ein Aufhebungsvertrag besser als eine Kündigung?
Kommt darauf an. Ein fairer Aufhebungsvertrag kann Vorteile bringen (z. B. bei Zeugniserstellung), birgt aber auch Risiken wie eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld (§159 SGB III). Deshalb sollte er niemals unüberlegt unterschrieben werden.
Sollte ich mich während der Probezeit gewerkschaftlich organisieren?
Unbedingt. Gewerkschaften bieten Rechtsschutz, Beratung und strategische Unterstützung – besonders in kritischen Situationen wie Kündigung oder Vertragsverhandlung. Wer rechtzeitig Mitglied wird, ist im Ernstfall besser geschützt.
Urlaubsentgelt bei Kündigung: Dein Anspruch in Zahlen erklärt 👆